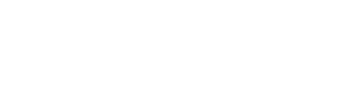Die urbane Ladeinfrastruktur auf dem Prüfstand
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein zentrales Thema für die Elektromobilität – besonders im dichten, urbanen Raum. Herkömmliche Ladesäulen stoßen oft an räumliche und gestalterische Grenzen. Genau hier setzt eine neue Lösung an: der Ladebordstein. In Köln wurde dieses Konzept ein Jahr lang getestet. Die Ergebnisse sprechen für sich – und könnten den Wandel in der Stadtmobilität beschleunigen.
Unauffällig, effektiv und stadtraumtauglich: Der Ladebordstein im Detail
Die getesteten Ladebordsteine wurden an zwei Standorten in Köln-Lindenthal installiert und unter realen Bedingungen auf Herz und Nieren geprüft. Über 2.800 Ladevorgänge, eine Verfügbarkeit von über 99 % und rund 50 MWh geladene Energie belegen nicht nur die technische Reife, sondern auch die hohe Akzeptanz bei den Nutzern.
Mit einer durchschnittlichen Ladeleistung von 19 kWh pro Ladevorgang – das entspricht etwa 120 Kilometern Reichweite – zeigt sich, dass die Lösung auch für den täglichen Pendelverkehr geeignet ist. Die modulare Bauweise ermöglicht zudem einen einfachen Austausch defekter Module, was die Betriebskosten niedrig hält und die Wartung erleichtert.
Was die Menschen überzeugt hat
Ein entscheidender Erfolgsfaktor des Ladebordsteins ist die Nutzerfreundlichkeit. Über 100 Nutzerinnen und Nutzer gaben in einer Befragung Rückmeldung. Besonders positiv bewertet wurden Aspekte wie die einfache Bedienbarkeit, die Möglichkeit zur Einhandbedienung und das direkte Anfahren von der Straße aus – ganz ohne störende Poller oder frei liegende Kabel.
Die durchschnittliche Bewertung lag bei 4,38 von 5 Punkten – ein klares Signal für die Akzeptanz der Technologie. Auffällig war auch die hohe Zufriedenheit älterer Teilnehmender, was auf die barrierearme Gestaltung der Lösung zurückzuführen ist.
Vorteile für Stadtplanung und Verkehr
Der Ladebordstein fügt sich nahezu unsichtbar ins Stadtbild ein und bewahrt wichtige Sichtachsen – ein Pluspunkt gegenüber klassischen Ladesäulen. Gleichzeitig reduziert er durch seine Bauweise die Gefahr von Stolperfallen und Vandalismus.
Für Städte und Kommunen ist vor allem die schnelle und kostengünstige Installation ein Vorteil. Die Möglichkeit zur Vorverlegung sogenannter Hohlbordsteine erlaubt eine flexible Erweiterung der Ladeinfrastruktur, ohne invasive Bauarbeiten. So können Kommunen auf steigende Nachfrage reagieren, ohne lange Planungszeiten oder hohe Investitionen.
Verbesserungspotenzial und Zukunftsperspektive
Trotz der positiven Bilanz gibt es Optimierungspotenzial: Einige Teilnehmende wünschten sich eine bessere Sichtbarkeit der Ladepunkte. Hier könnten stärkere Markierungen sowie die Integration in digitale Navigations- und Lade-Apps Abhilfe schaffen.
Technisch wurde während des Projekts bereits nachgebessert: Eine verbesserte Schmutzableitung und zusätzliche Beleuchtung erhöhen den Bedienkomfort. Damit ist der Ladebordstein nun serienreif und bereit für den Einsatz in deutschen Städten.
Der Ladebordstein als Schlüssel zur urbanen Elektromobilität
Der Ladebordstein vereint Praxistauglichkeit, gestalterische Zurückhaltung und technische Effizienz – eine Kombination, die ihn zu einem zentralen Baustein für die urbane Ladeinfrastruktur macht. Gerade in verdichteten Stadträumen, wo klassische Lösungen an ihre Grenzen stoßen, bietet er eine echte Alternative.
Die positiven Ergebnisse aus Köln zeigen, dass diese Lösung nicht nur funktioniert, sondern bei den Menschen gut ankommt. Jetzt liegt es an Städten und Kommunen, diese Chance zu nutzen.